

von Björn Jensen
veröffentlicht 1990
Erhältlich als Buch und Kindle E-Book
bei Amazon
Einführung: Ähnlich wie der literarische Essay sich lange Zeit einer genaueren wissenschaftlichen Untersuchung sperrte und erst in den sechziger Jahren dieses Jahrhunderts eingehend untersucht wurde, fand der Essay-Film bisher kaum Beachtung in filmtheoretischen Abhandlungen. Auch die Filmemacher sind sich ihrer stilistischen Verwandtschaft zum Essay nur selten bewußt und versehen ihre Filme daher mit den unterschiedlichsten Titeln. Das zweite Kapitel dieser Arbeit wird sich zuerst einmal mit dem Begriff des "Essays" in Literatur und Film auseinandersetzen, sowie seine historische Entwicklung nachzeichnen, um ihn schließlich vom Dokumentarfilm abzugrenzen.
Als Wim Wenders 1981 seinen Film "Nick's Movie - Lightning Over Water" in die deutschen Kinos brachte, stieß er damit weitgehend auf Ablehnung und Unverständnis. Man warf ihm vor, das Sterben Nicholas Rays für seine Zwecke ausgenützt zu haben. Es wurde von Peinlichkeiten und überlegener Selbstdarstellung gesprochen. Der Grund, warum dieser Film vor allem in Deutschland so negativ aufgenommen wurde, mag mit unserem Verhältnis zum Tod zusammenhängen, das von dem amerikanischer oder auch dem anderer Europäischer Staaten sehr verschieden ist. Zum anderen mag es damit zusammenhängen, daß der Essay-Film ähnlich wie der literarische Essay sehr viel schwerer in Deutschland Fuß fassen konnte, als in anderen Ländern.
Die vorliegende Arbeit bemüht sich, Nick's Movie aus verschiedenen Perspektiven zu beleuchten, um so der Qualität dieses Filmes gerecht zu werden. Er wird dabei in die Tradition des Essay-Filmes und des Todesdiskurses im Film gestellt. Ebenso werden Parallelen zu Wenders' und Rays früheren Filmen gezogen werden. Auf der Grundlage einer mikrostrukturellen Analyse des Films (vgl. das Filmprotokoll in Teil 2 dieser Arbeit), wird der Film auf seinen narrativen Aufbau, seine visuelle und akustische Gestaltung und essayistischen Elemente hin untersucht werden.
Mit über 35 Jahren Erfahrung in der Medienbranche, mehr als 140 Filmen und Projekten und Hunderten von Kursen und Workshops.

Photo: © Docroads

Photo: © Docroads
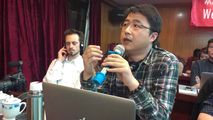
Photo: © Björn Jensen

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Docroads

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Björn Jensen

Photo: © Sabine Hackenberg/Haus des Dokumentarfilms